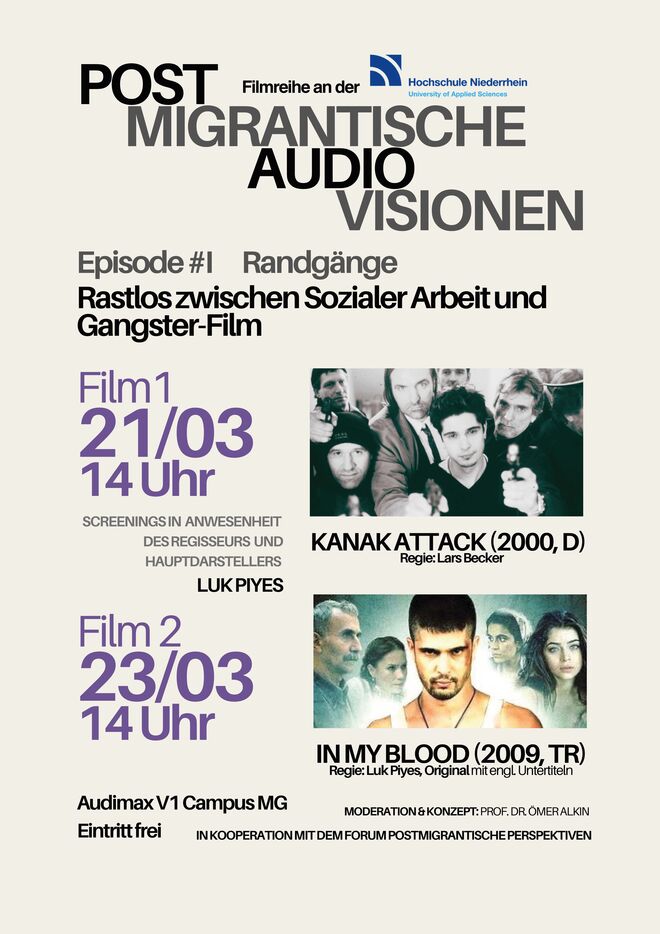Einführung in den Film
Prof. Dr. Sascha Schierz, Soziologe
im Anschluss gemeinsame Podiumsdiskussion
Till Hastreiter (Regisseur) & Prof. Dr. Donja Amirpur (Moderation)
Reihenkonzept: Prof. Dr. Ömer Alkin (Hochschule Niederrhein)
Wann: 29.11.2023 um 17 Uhr
Wo: „Das Westend. Gemeinschaftszentrum“, Alexianerstraße 6, 41061 Mönchengladbach
Eine Veranstaltung im Kontext der Reihe „50 Jahre Hip Hop – (No) Midlife Crisis?“
in Kooperation mit „Forum Postmigrantische Perspektiven“ und der Stadt Mönchengladbach.
Was bedeutet es, wenn Hip Hop im deutschsprachigen Raum postmigrantisch genannt wird? Steht das Label einerseits für eine empowernde Sicht auf Migrant:innen selbst, die sich nicht mehr der Fremdbezeichnung und integrationspolitischen Einordnung als „Problem“ fügen wollen, so steht es andererseits auch für die Suche nach neuen Räumen und Identitäten und ist damit als Findung einer Utopie gemeint. Für Hip Hop bedeutet das auf der einen Seite, dass es immer schon postmigrantisch war, weil er sich z.B. in Form des Gangsta Rap sprachlich und inhaltlich anti-hegemonial positionierte. Auf der anderen Seite ist Hip Hop wegen seiner hybriden Herkunft und Vermischungspotentiale auch immer schon eine Heterotopie, also ein realisierte Utopie gewesen, die das Neue in Musik, Graffiti, Tanz zu realisieren suchte. Kann ein Film postmigrantisch sein, der vor mehr als 20 Jahren schon zuvor fiktionalfilmisch Ungesehenes auf die Leinwand und Bildschirme brachte? Nämlich die Berliner Hip Hop-Szene.
Zum Nachdenken, ob und wie also Hip Hop immer schon oder auf neue Art und Weise postmigrantisch ist und war, laden die Postmigrantischen Audiovisionen den Film “Status Yo” (D, 2004), das Publikum und Expert:innen zu dem Thema ein, um im Jugendzentrum Westend darüber zu diskutieren.
Till Hastreiter ist Regisseur und gemeinsam mit Robert Ralston Inhaber der Filmproduktionsfirma „Gute Filme“. Er lebt und arbeitet in Berlin und der Schweiz.
Prof. Dr. Sascha Schierz ist Professor für Jugendsoziologie und Soziologie sozialer Kontrolle an der Hochschule Niederrhein, Fachbereich 06 Sozialwesen. Er forscht und publiziert zu den Themenfeldern Stadt bei Nacht/Nachleben, städtische Sozialkontrolle, digitale Überwachung in Strafvollzug und Bewährungshilfe. Im Rahmen seiner Promotion und weiterer Veröffentlichungen beschäftigte er sich unter anderem mit Graffitiwriting in New York und Deutschland.
Dr. Donja Amirpur ist Professorin für Migrationspädagogik am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein und Diversitäts- und Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereiches. Ihre Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Migrationspädagogik, intersektionale und rassismuskritische Soziale Arbeit, postmigrantische Kulturarbeit, Kindheits- und Familienforschung (hier arbeitet sie insbesondere zur Verwobenheit von Rassismus und Ableismus). Sie ist Mitherausgeberin der Zeitschrift für erziehungswissenschaftliche Migrationsforschung (ZeM).