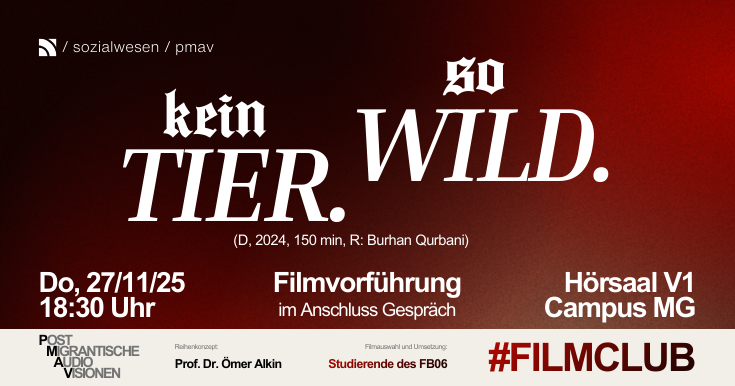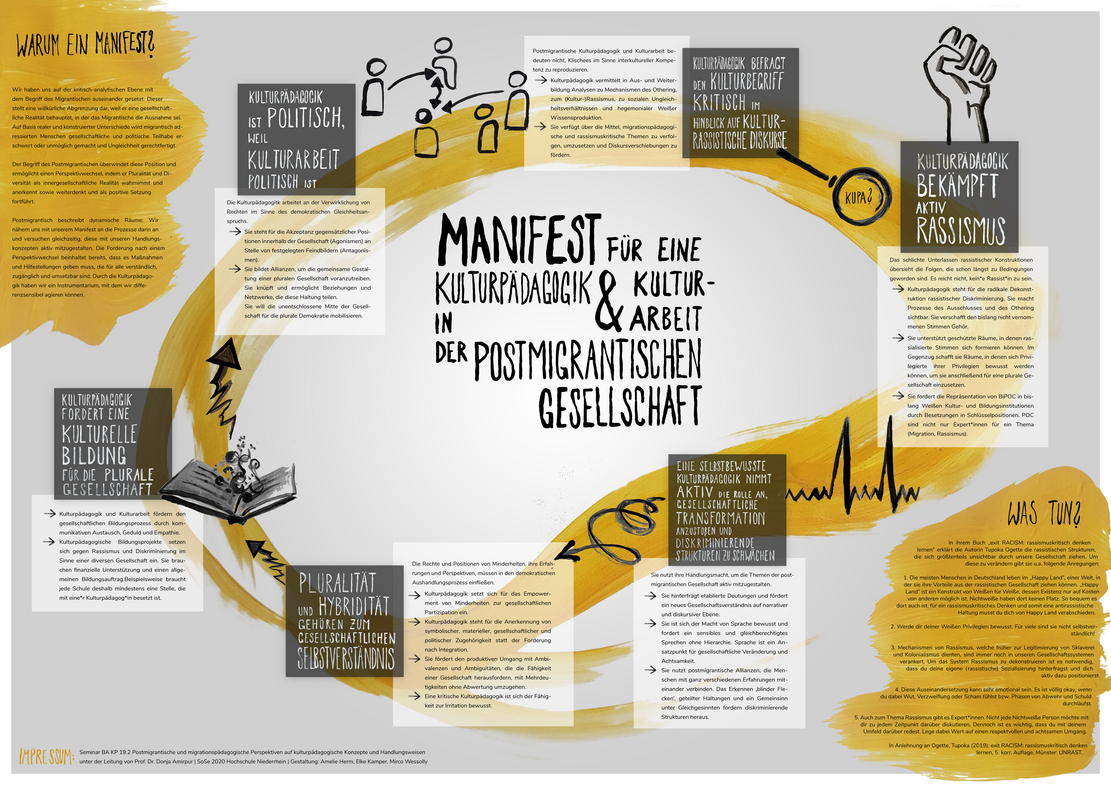Der Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Niederrhein kann auf eine über 50-jährige Tradition zurückblicken. Zeitgleich nehmen jährlich rund 2000 Studierende an unserem Fachbereich das Lehrangebot in den Bachelor- und Masterstudiengängen der Sozialen Arbeit, der Kulturpädagogik und der Kindheitspädagogik wahr.
Wir befähigen unsere Studierenden auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden zum selbstständigen professionellen Handeln in den jeweiligen Berufs- und Handlungsfeldern sowie zur Entwicklung von sozialen Innovationen.
Unser Fachbereich bietet Antworten auf aktuelle und zukunftsbezogene Herausforderungen in Politik und Gesellschaft. Grundlage unseres Denkens und Handelns sind die Menschenrechte und damit Achtung, Wertschätzung und Anerkennung von Vielfalt. Ziel ist die Befähigung zur verantwortungsbewussten, wissenschaftlich fundierten Gestaltung von Lebenswelten der Menschen, mit denen wir in den Berufs- und Handlungsfeldern arbeiten.
Weiterführende Informationen
► Die Leitlinien des Fachbereiches
► Die Organisation am Fachbereich