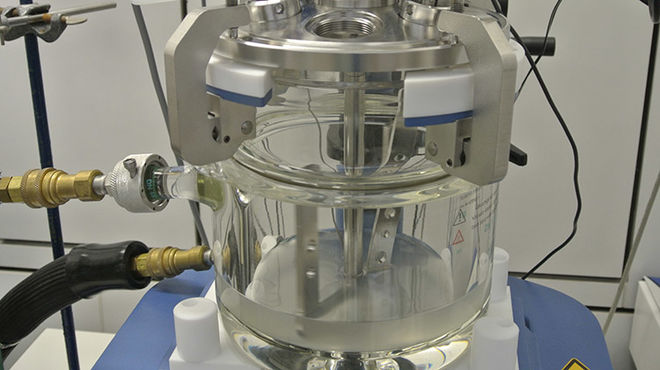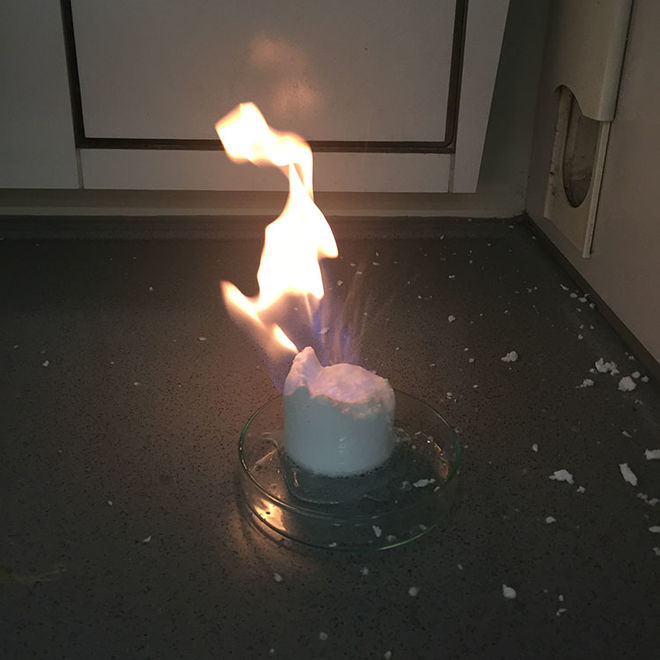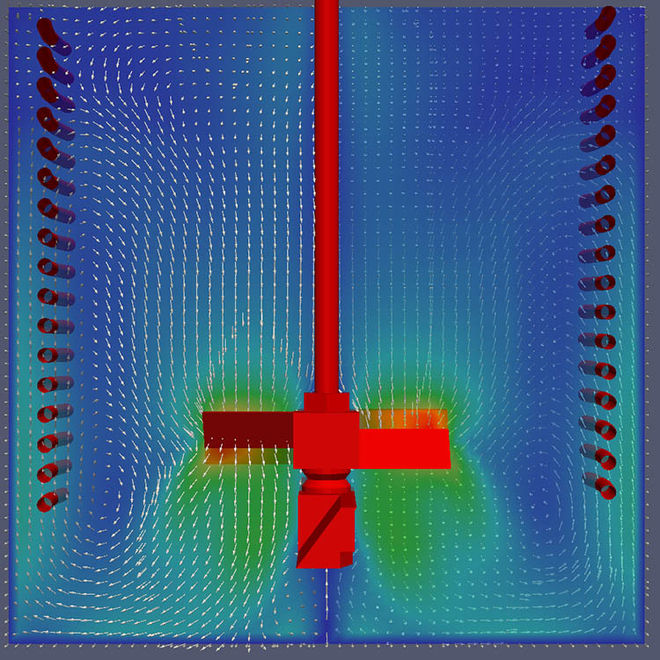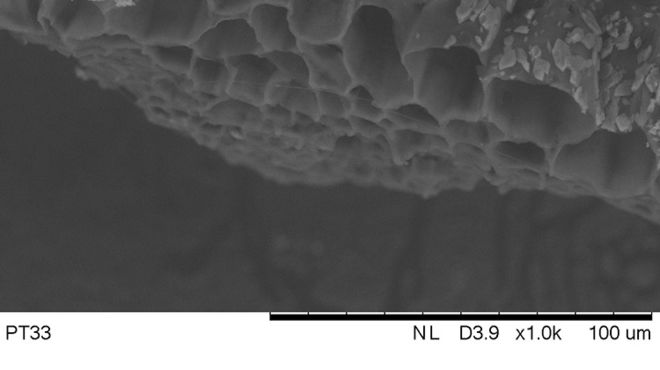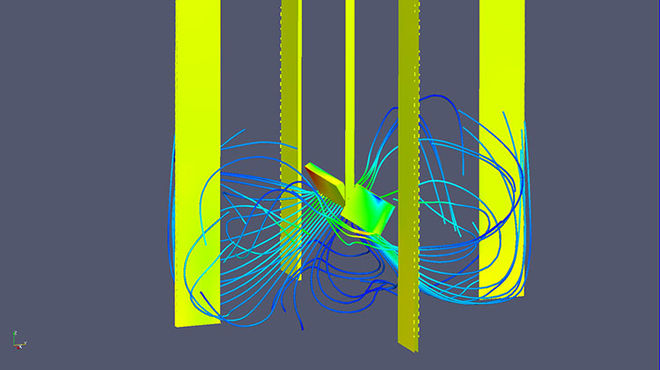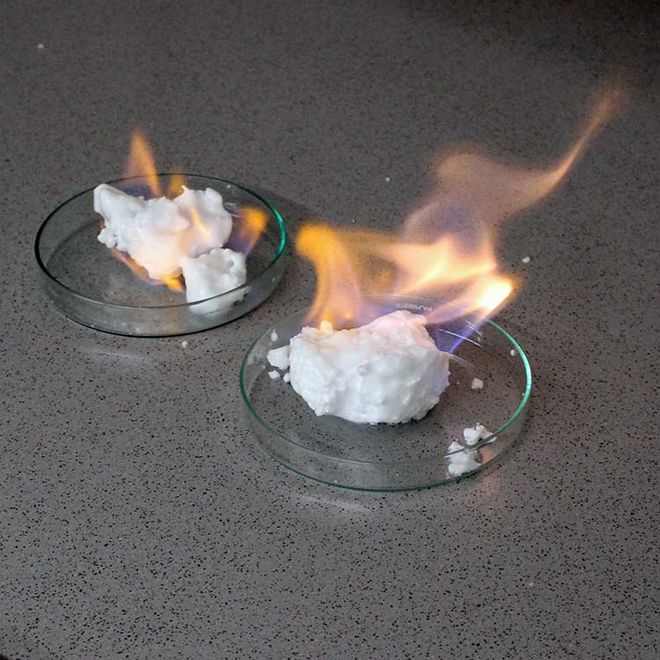Akademische Vita
Name: Prof. Dr.-Ing. habil. Heyko Jürgen Schultz
Professur für Chemische Technik an der Hochschule Niederrhein, Fachbereich 01 - Chemie, seit 01.01.2011
Zusätzliche Funktionen:
- Mitglied im Institutsrat des Institutes ILOC (Institut für Lacke und Oberflächenchemie)
- Mitglied des Graduierteninstituts NRW, Fachgruppe Ressourcen
- Beiratsmitglied der Fachgruppe "Mischvorgänge" der DECHEMA/ProcessNet
- Mitglied des Fachbereichsrates des Fachbereichs Chemie der HSNR
- Budgetbeauftragter des Fachbereichs Chemie der HSNR
- Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Fachbereichs Chemie der HSNR
- Vorsitzender des QV-Mittelausschusses des Fachbereichs Chemie der HSNR
Zuordnung zu Forschungsschwerpunkten der HSNR:
- Innovative Produkt- und Prozessentwicklung
- Energieeffizienz
Preise und Auszeichnungen:
- Heinrich-Mandel-Preis für Kraftwerkstechnik 2004, VGB-Forschungsstiftung, 10/2004
- Lehrpreis der Hochschule Niederrhein 2014, Kategorie „Innovationen in Lehre und Betreuung an der Hochschule“, Hochschule Niederrhein, 12/2014
- Lehrpreis der Hochschule Niederrhein 2020, Kategorie „Bestes Betreuungs- und Interaktionsangebot in der digitalen Lehre“ für die Veranstaltung „Chemische Verfahrenstechnik“, Hochschule Niederrhein, 01/2021
Prof. Dr. Schultz on Researchgate ->